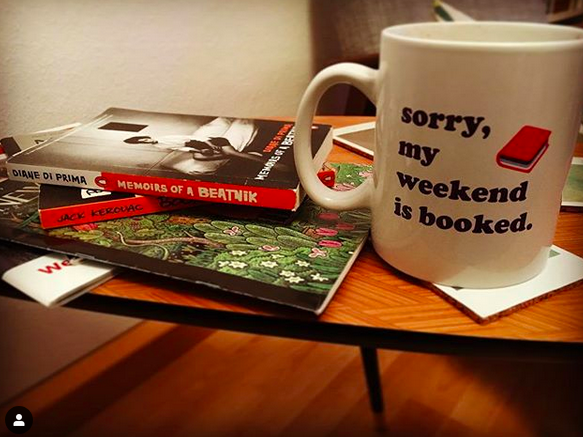Einreisen kann ich als Wahlwienerin offiziell nur unter Quarantäneauflagen; 10 Monate war ich nicht mehr in Osnabrück. Und während sich die Hälfte der Stadt fragt, wann die Ausgangssperre kommt, wundere ich mich, warum man die schönsten Träume von Osnabrück im Wiener Lockdown träumt.
„Osnabrück? Wo ist das denn?“, fragen mich die Wienerinnen jedes Mal, wenn ich ihnen von meiner Heimatstadt erzähle. Ich sage dann, dass das bei Hamburg liegt, denn Hamburg kennt man überall, und jede von uns, die einem Haufen US-Amerikanerinnen im Thailand-Urlaub schon mal erklären musste woher sie kommt, weiß, wovon ich rede.
Aber wer seine Jugend in Hamburg verbracht hat, der wird nicht verstehen, was wir in Osnabrück erlebt haben – wir, die am EMA oder im Schinkel zur Schule gegangen sind, um uns freitagabends in den Clubs in Güterbahnhofsnähe die Snobs vom Carolinum schönzusaufen. Ausgestattet mit Red-Bull-Wodka in der Hand und Cola-Korn kümmerte es uns nicht, ob wir uns mit denen aus Walle oder vom Westerberg besoffen: In der Nacht war in dieser Stadt alles möglich.
Im Wiener Lockdown wirkt das alles so weit weg, und ich glaube, es kommt nie wieder. Vielleicht kann ich meine Familie in zwei oder drei Monaten sehen, vielleicht erst zu Weihnachten, wer weiß das schon. Gestern und heute sind nicht mehr, alles ist nur noch mein gelbes Sofa. Deswegen träume ich so viel von meinen Schuljahren in letzter Zeit: Es ist mein Unterbewusstsein, das das kleine Osnabrücker Nachtleben in meinem Kopf zu etwas Großem heraufbeschwört. So wird es zu einem Mythos, den es so wahrscheinlich nie gegeben hat.
Damals mit 18 hatten wir dummen weißen Kids noch keine Ahnung vom Klassenunterschied – und ich meine nicht den zwischen der 11a und 11b. Wir wussten nicht, dass es etwas bedeutete, ob du aus einem Bildungsbürgerhaushalt aus dem Katharinenviertel kommst oder aus einem Gastarbeiterplattenbau in Haste. Aber spätestens als es darum ging, wer Medizin oder Jura in München studieren sollte, wurde klar, dass Herkunft doch etwas zählt. Nicht nur deswegen haben die mit Talent, aber ohne die nötigen Kontakte die Stadt Richtung Berlin und Castrop-Rauxel verlassen, um sich an Weihnachten in der Kleinen Freiheit immer wieder in den alten Geschichten zu ertränken.
Aber was machten diese Unterschiede damals im Mondflug, im Sonnendeck, was zählte das in der Freiheit, wo wir Wochenende für Wochenende unser Osnabrücker Glück fanden und dachten, es würde ewig so weitergehen? Sehr wohl zählte das alles etwas im Alando, wo vermutlich der hochgestellte Kragen erfunden wurde und die Türsteher das Hausrecht so aggressiv gegen Migratinnen durchprügelten, dass ich mich heute noch schäme, dort jemals mit langweiligen Biodeutschen abgestürzt zu sein.
In den vielen anderen Clubs war so viel Liebe in der Luft, so lange bis die letzten von uns grölend in die Altstadt zogen und der Nebenjob im Callcenter alleine deswegen Sinn ergab, weil genug Geld übrig war, um dem Opa in Gerdas Frühgaststätte einen Sambuca auszugeben. Jetzt, da kein Club mehr aufhat, jetzt, da niemand mehr tanzen geht, meine ich, dass die Tanzflächen von Osnabrück mich am besten gehalten haben.
Ich erinnere mich an ein Cäthe-Konzert im Rosenhof mit meiner besten Freundin. Die Hälfte hatten wir bereits verpasst, weil der Wein so billig war und wir uns so lange nicht gesehen hatten. Als wir es doch noch in den leeren Moshpit schafften, weil Osnabrück so eine seltsame Mischung an echtem Musikverständnis und vollkommener Ignoranz an den Tag legen kann, tanzten wir zu Ich muss gar nichts. Das haben wir gelernt in Osnabrück, wo sowieso jeder über jede redet: Wir lernten so zu sein, wie Jungs immer schon sein durften. Wir überholten sie sogar, denn meine beste Freundin und ich waren immer noch die Lautesten an der Theke. Und unsere Schwestern in der Freiheit und im Mondflug waren noch viel lauter.
Aber in einer Stadt, die 50 Wörter für Regen hat, müssen zwangsläufig Menschen leben, die gerne reden. Dieses unnachahmliche Sabbeln habe ich in meinem Wiener Lockdown oft im Ohr. Ich erinnere mich, wie ich 2019 auf dem Weihnachtsmarkt am Dom überhörte, wie eine Frau ihren Mann fragte, ob er „Schampingjons“ essen wolle.
„Die mach ich doch gar nicht“, antwortet er darauf schroff, was bei uns nicht heißt, dass er sie selber nicht zubereitet, sondern dass er sie einfach nicht mag. In Osnabrück überhörst du solche Gespräche dauernd, weil dir jeder alles platt vorn Kopf sagt. Da schlägt das Norddeutsche durch, da isst man nichts, was man nicht mag – und man sagt nichts, was man nicht denkt.
Selbst, wenn es mich viele Nerven gekostet hat und vieles in dieser Stadt so kleingeistig sein kann, dass die Flucht nach Wien der einzige Ausweg schien: In den letzten Jahren hatte ich wegen Osnabrück öfter Pipi in den Augen, als ich es zugeben wollte. Weil ambitionierte Linke die AfD vom Rathausplatz pfiffen oder weil die Stadt die ersten geflüchteten Kinder aus Moira aufgenommen hatte. Auch jetzt gehörte Osnabrück zu den ersten deutschen Städten, die kostenlose Corona-Teststationen einführten, um Cluster zu durchbrechen und andere zu schützen. Das linke Osnabrück, das gegen soziale Probleme, Rassismus und die Ungleichheit der Geschlechter kämpft; das ist jenes, von dem ich meinen Wiener Freundinnen am liebsten erzähle. Nur diesem fühle ich mich noch zugehörig.
Und wenn solche Nachrichten auch in Wien groß in den Medien sind, sage ich: „Osnabrück ist übrigens meine Heimatstadt.“
Auf die Nachfrage, wo zum Teufel das denn sein soll, füge ich nur noch leise hinzu: „Irgendwo bei Hamburg halt.“
[LN1]https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/2088636/afd-demo-vor-dem-osnabruecker-rathaus-von-gegnern-uebertoent
[LN2]https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/fluechtlinge-griechenland-fluechtlingslager-kinder-aufnahme-osnabrueck
[LN3]https://taz.de/Auf-der-Suche-nach-Infizierten/!5748510/